☕ Der Sinn des Lebens liegt zwischen dem dritten Kaffee und dem achten Chrome-Tab
Ein metaphysischer Nervenzusammenbruch in mehreren Browserfenstern
🛌 Kapitel 1: Der Tag beginnt mit Versagen
Ich wache auf und hasse alles. Nicht aus metaphysischer Überzeugung, sondern weil mein Wecker – „Digitaler Hahn Deluxe 3000“ – mich mit exakt jenem Klingelton weckt, der klingt wie eine quietschende Straßenbahn, die existentialistische Schreie ausstößt.
Der erste Kaffee ist Pflicht. Der zweite ist ein Menschenrecht. Der dritte ist ein Statement. Ich trinke ihn aus einer Tasse, auf der steht: „Not today, Satan. I’m already overbooked.“ Während der Kaffee durch meine kaputten Synapsen sickert, versuche ich, mich an mein WLAN-Passwort zu erinnern. Es besteht aus einem Versmaß, das nur in Alt-Runen geschrieben existiert und von mir „sicher“ gewählt wurde, als ich noch jung und voller Hoffnung war. Also vor zwei Jahren.
Aber bevor ich auch nur daran denken kann, mein Gehirn zu rebooten, stolpere ich auf dem Weg in die Küche über eine leere Amazon-Verpackung. Sie liegt da wie ein Symbol meiner selbst – leer, unbrauchbar, aber irgendwie trotzdem aufgeladen mit Schuldgefühlen, weil sie da ist. Ich erinnere mich nicht mal mehr, was drin war. Wahrscheinlich etwas, das mir in dem Moment sinnvoll erschien. Vielleicht ein Gerät, das verspricht, mein Leben zu optimieren. Vielleicht eine LED-Lichterkette in Form von Kakteen. Vielleicht Hoffnung in Kartonform.
Ich starte mein Tagesgerät – einen alten Laptop, der bei jedem Hochfahren klingt, als würde er einen letzten Atemzug ausstoßen. Der Bildschirm flackert kurz, als würde er sagen: „Wirklich? Schon wieder du?“ Ich respektiere seinen Widerwillen. Ich teile ihn.
Meine Wohnung riecht nach kaltem Kaffee, Druckerpapier und Selbstverleugnung. Die Rollos sind unten. Nicht, weil ich schlafen will, sondern weil ich so tue, als gäbe es draußen nichts. Kein Wetter, keine Menschen, keine Realität, die auf mich wartet wie eine unangenehme Email im Spam-Ordner des Universums.
Ich gehe ins Bad, blicke in den Spiegel. Dort steht jemand mit einem Gesicht, das aussieht, als wäre es gleichzeitig müde, enttäuscht und leicht überrascht, dass es noch existiert. Ich versuche zu lächeln. Mein Spiegelbild wirkt erschrocken. Ich auch.
Ich dusche, aber nur körperlich. Die Seele bleibt ungeduscht. Der Wasserstrahl trifft mich wie eine absurde Erinnerung daran, dass alles ständig fließt – nur meine To-do-Liste nicht. Sie bleibt wie ein Museum unerledigter Träume: „Sport machen“, „endlich Steuer“, „Roman anfangen“. Ich denke an Kafka. Ich denke an Toast.
Zurück in der Küche. Ich öffne das Fenster und werde von einem Möwenschrei überrascht. Ich lebe 70 Kilometer vom Meer entfernt. Entweder bin ich verrückt – oder die Möwe ist es. Ich nicke ihr respektvoll zu.
Ich schütte Kaffee in mich rein wie einen Exorzismus. Schwarz. Ohne Zucker. Ohne Hoffnung. Nur flüssiger Wille. Es ist dieser Moment zwischen Wachwerden und totaler Kapitulation, in dem ich mich frage: „Wer hat eigentlich entschieden, dass das Leben morgens beginnt?“
Ich bin sicher, Nietzsche hätte Frühstück gehasst. Ich auch.
🧠 Kapitel 2: Chrome, mein Therapeut, mein Feind, mein Spiegel
Chrome startet. Die Tabs öffnen sich wie alte Schulfreunde, die nie fragen, wie’s dir geht, sondern direkt von ihrem Scheiß erzählen. Jeder Tab ist eine Tür zu einem parallelen Universum, in dem ich jemand anderes bin. Produktiver. Informierter. Weniger… ich.
- Tab 1: Mails. 76 ungelesene Nachrichten. 63 davon von mir selbst, weil ich Dinge vergesse und mir Erinnerungen schicke wie ein dementer Postbote. Betreffzeilen wie: „UNBEDINGT HEUTE ERLEDIGEN!!!“ – aus dem Februar.
- Tab 2: YouTube. Ich will lernen, wie man ein Brot backt. Schaue aber ein Video über Ziegen, die schreien wie Menschen. Algorithmus: Du bist ein Spiegel meiner Zerstreuung.
- Tab 3: Google-Suche: „Bin ich noch Mensch, wenn ich keine Mittagspause mehr fühle?“ Antwort: „Vielleicht bist du schon Software.“ Danke.
- Tab 4: Wikipedia-Eintrag über Biber. Ich weiß nicht mehr warum. Irgendwas mit Dammbau und Depressionen. Ich lese über das Paarungsverhalten von Nagetieren und denke an meine letzte Beziehung. Es gab Parallelen.
- Tab 5: Twitter. Ich lese 48 Meinungen zu einem Thema, das ich nicht kenne, und hasse jetzt alle Beteiligten. Inklusive mir selbst. Ich scrolle weiter. Jemand hat ein Meme über Existenzangst gepostet. Ich like es. Solidarität durch Verzweiflung.
- Tab 6: Online-Shop. Ich lege eine Lavalampe in den Warenkorb. Lösche sie wieder. Lege sie wieder rein. Ich bin emotional nicht bereit für diese Entscheidung.
- Tab 7: ChatGPT. Ich tippe: „Was ist der Sinn des Lebens?“ und bekomme: „Das hängt von deiner Perspektive ab.“ Danke, du binärer Buddha.
- Tab 8: Google Docs. Hier schreibe ich diesen Text, während ich so tue, als würde ich arbeiten. Willkommen in der Matrix der Produktivität.
Meine Tabs sind mein Tagebuch. Jedes Fenster ein Eintrag. Jeder Verlauf ein Gedicht voller digitaler Verdrängung. Wenn Chrome abstürzt, verliere ich mehr von mir als bei jeder Trennung.
Ich öffne einen neuen Tab. Ohne Ziel. Einfach nur, weil Leere Platz braucht. Ich schaue mir Hintergrundbilder von norwegischen Fjorden an. Ich will fliehen. Aber nur geistig. Körperlich ist es zu anstrengend. Außerdem müsste ich packen. Und dafür bräuchte ich ein zweites Gehirn.
Ich wechsle zwischen Tabs wie zwischen Persönlichkeiten. In Tab 2 bin ich Foodblogger. In Tab 4 ein Zoologe. In Tab 5 ein zynischer Kommentator der Weltlage. In Tab 6 ein Kind mit Kreditkarte. Und in Tab 8… ein Autor mit Ambitionen und Kaffeeatem.
Meine Bildschirmzeit ist ein Massengrab guter Vorsätze. Ich habe eine App, die sie trackt. Sie meldet mir, dass ich heute schon 7 Stunden vorm Rechner saß. Es ist 10:17 Uhr.
Ich schließe alle Tabs. Sofort öffne ich sie wieder. Ich kann nicht ohne. Sie sind mein Kollektivgedächtnis. Mein digitales Nervensystem. Meine Prokrastinationsfamilie.
🤯 Kapitel 3: Metaphysik mit Milchkaffee
Der dritte Kaffee. Es ist dieser eine Moment, in dem man noch glaubt, der Tag könnte sich wenden, obwohl man tief im Inneren weiß, dass er längst beschlossen hat, ein Arschloch zu sein. Ich sitze da mit meinem dampfenden Becher Hoffnung und denke über das Leben nach. Nicht freiwillig – es passiert einfach. Wie ein Softwareupdate mitten in der Präsentation: ungefragt, lästig, aber unvermeidbar.
Ich beginne zu googeln. Nicht weil ich Antworten will. Ich will Bestätigung. Ich will, dass jemand – irgendwer – da draußen denselben Quatsch empfindet wie ich. Also tippe ich:
- „Was ist der Sinn des Lebens, aber realistisch?“
- „Wie viele Kaffees sind tödlich?“
- „Bin ich depressiv oder einfach nur realistisch?“
- „Woran erkennt man, dass man existiert?“
Die Antworten variieren zwischen Kalendersprüchen und Reddit-Foren, in denen sich Menschen gegenseitig versichern, dass sie auch nicht mehr wissen, warum sie ihre Zimmerpflanze „Systemfehler“ genannt haben.
Ich scrolle und denke: Vielleicht bin ich gar kein Mensch, sondern nur ein besonders tragisches Browser-Plugin mit Neurose-Funktion. Ich existiere nur, solange Tabs offen sind.
Irgendwo zwischen einem Philosophie-Artikel über Camus und einem Blog über „Mindful Müsli-Meditation“ stelle ich mir die ultimative Frage: Hat der Mensch überhaupt noch eine metaphysische Existenz, wenn er nie mehr als vier Sekunden am Stück ununterbrochen denkt, ohne Benachrichtigung?
Und während ich das frage, poppt eine Notification auf: „Neues Video von ‚Was wäre wenn Bienen kämpfen könnten‘ online!“ Ich klick. Natürlich.
Ich versuche mich zusammenzureißen. Meditieren. Ich lade eine App herunter, die mir in beruhigender Stimme sagt: „Schließe die Augen und lasse deine Gedanken los.“ Klingt schön. Aber ich hab Angst, dass meine Gedanken nicht zurückkommen. Was, wenn sie frei sind? Und ich zurückbleibe – mit meinem vierten Kaffee und einem halben Müsliriegel zwischen Tastatur und Selbstbild.
In einem anderen Tab entdecke ich ein Interview mit einem Philosophieprofessor, der erklärt, dass das Ich eine Illusion sei. Ich nicke zustimmend, obwohl ich gleichzeitig versuche, mir ein Hoodie mit dem Aufdruck „Nihilist but make it cozy“ zu bestellen.
Dann entdecke ich das Konzept der Apophänie – das Phänomen, in allem Muster zu sehen, auch wenn keine da sind. Ich denke sofort: „Wie mein ganzes Leben.“
Meine metaphysischen Gedanken kreisen wie ein kaputter DVD-Player, der versucht, in einem Stream zu funktionieren. Immer wenn ich denke, ich bin kurz davor, etwas wirklich Tiefes zu erkennen, meldet sich mein Magen mit einem Geräusch, das klingt wie ein beleidigter Karpfen.
Ich hole mir einen Snack. Dabei öffne ich einen neuen Tab. Dort steht: „10 Dinge, die erfolgreiche Menschen niemals tun.“ Punkt 1: „Sie starten ihren Tag niemals mit Social Media.“ Ich fühle mich gesehen. Ich fühle mich verurteilt. Ich scrolle weiter.
Plötzlich erinnere ich mich an ein Zitat aus „Per Anhalter durch die Galaxis“: „Die meisten großen Wahrheiten sind einfach. Die meisten einfachen Wahrheiten sind falsch. Und die meisten falschen Wahrheiten sind beliebt.“ Ich notiere es. Für später. Oder fürs nächste Tattoo.
Ich trinke weiter. Der Kaffee ist mittlerweile lauwarm, aber das passt. Auch mein Enthusiasmus ist es. Ich google: „Kann Kaffee Gefühle haben?“ Antwort: „Unwahrscheinlich.“ Ich fühle mich ausgeschlossen.
Die Welt ist zu groß, um sie zu begreifen. Aber mein Kopf ist zu klein, um sie zu ignorieren. Ich schwebe irgendwo dazwischen: ein metaphysischer Zwischenzustand mit Bildschirmblendung. Vielleicht liegt der Sinn des Lebens nicht im Verstehen. Vielleicht liegt er im Weiterklicken.
📶 Kapitel 4: WLAN, Walhalla und Wahnsinn
Es gibt Momente im Leben, in denen alles stillsteht. Nicht metaphorisch – wirklich. Zum Beispiel, wenn das WLAN ausfällt. Es ist wie ein plötzlicher Kälteeinbruch im neuronalen Netzwerk der Seele. Ich sitze da, mitten in meinem virtuellen Multiversum, Tabs offen wie Fenster in verschiedene Dimensionen – und plötzlich: Verbindung getrennt.
Zuerst denkt man: Das ist ein Fehler. Ein Wackler. Ein kosmisches Zucken. Ich checke mein Gerät. Ich drücke F5. Ich ziehe den Routerstecker raus und rein wie ein Priester mit Ritualpanik. Nichts passiert.
Der Cursor dreht sich wie ein verlorener Satellit. Ich bin abgeschnitten. Isoliert. Nicht nur vom Internet, sondern auch von meiner Existenz. Denn wenn man ehrlich ist: Wer bin ich ohne Internet? Ein Körper mit Kaffee im Blut und keiner Ahnung, wie man „Couscous kocht“, ohne es zu googeln.
Ich wandere durch meine Wohnung. Das Licht flackert, aber nur in meinem Kopf. Der Kühlschrank summt. Der Router blinkt rot. Ich starre ihn an, als hätte er mir persönlich das WLAN entzogen, um mich zu strafen. Vielleicht bin ich zu oft fremdgegangen – zu viele Tabs, zu viele Streams, zu wenig Dankbarkeit.
Ich beginne, mich an analoge Tätigkeiten zu erinnern. Bücher. Papier. Bleistifte. Ich finde ein altes Notizbuch. Die erste Seite begrüßt mich mit: „Hier beginnt dein neues Ich.“ Die zweite Seite enthält eine Einkaufsliste aus dem Jahr 2020 und ein sehr schlechtes Gedicht über Knäckebrot.
Ich versuche zu lesen. Richtig zu lesen. Nicht scannen. Nicht querlesen. Sondern Zeile für Zeile. Es ist ein Buch über Philosophie. Die Einleitung beginnt mit: „Was bedeutet es, zu denken?“ Ich klappe es wieder zu. Der Gedanke ist zu gefährlich ohne Google.
Ich setze mich wieder an den Schreibtisch. Öffne Word. Nur lokal gespeichert – wie ein U-Boot unter dem Datenmeer. Ich schreibe: „Es ist Tag 1 ohne WLAN. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalte.“
Ich schaue aus dem Fenster. Unten fahren Autos. Menschen gehen. Einer trägt eine echte Zeitung unter dem Arm. Ich bin fasziniert. Wie ein Archäologe bei einer Ausgrabung. Ich frage mich, ob er weiß, dass sein WLAN auch ausgefallen ist – oder ob er einfach so lebt.
Ohne Internet werden Gedanken plötzlich laut. Mein Gehirn füllt die Lücke mit allem, was es finden kann. Songtexte aus den 90ern. Einkaufszettel aus 2014. Der komplette Dialog einer Folge „Die drei ???“. Ich bin ein Museum meiner selbst – und die Ausstellung ist traurig.
Nach einer Stunde beginne ich, das WLAN-Signal im Raum zu suchen wie ein Goldgräber. Ich halte mein Handy hoch, bewege mich in Zeitlupe durch den Flur. Ein Balken. Zwei Balken. Weg. Ich hebe einen Fuß, halte den Atem an – drei Balken! Ich freeze wie ein Chamäleon auf LSD. Öffne den Browser. Hoffnung keimt. „Fehler: Keine Verbindung zum Server.“
Ich fluche. Dann flüstere ich dem Router zu: „Warum hasst du mich?“ Keine Antwort. Wahrscheinlich ist er gerade in seinem digitalen Zen.
Ich beginne zu schreiben. Richtig. Ohne Ablenkung. Ohne Wikipedia-Links. Nur ich und die Worte. Anfangs stockt es. Dann fließt es. Wie eine Therapie, bei der man endlich verstanden wird. Vielleicht ist die WLAN-freie Zone nicht die Hölle. Vielleicht ist sie das Walhalla der verlorenen Gedanken. Ein Ort, wo Ideen überleben, die sonst von Cat-Videos zerfetzt worden wären.
Aber dann – ein Geräusch. Das vertraute „Klick“ des Routers, wenn er sich neu verbindet. Ich schaue auf. Die Lampe blinkt grün. Ich öffne den Browser. Verbindung hergestellt.
Ich atme ein. Und gleichzeitig stirbt etwas in mir. Die Stille. Die Tiefe. Die Konzentration. Alles wird wieder übertönt vom digitalen Rauschen. Die Tabs kehren zurück. Die Nachrichten. Die Mails. Die Benachrichtigungen.
Ich merke, ich habe das Walhalla verlassen. Ich bin zurück in der Stadt der digitalen Stimmen. Und irgendwie… vermisse ich das Rauschen.
🧃 Kapitel 5: Zwischen Smoothie und Selbstaufgabe
Es ist 11:38 Uhr. Ich sitze auf meinem Küchenstuhl, das Rückgrat leicht gebogen wie ein Fragezeichen, das sich selbst nicht mehr traut. Vor mir: ein grüner Smoothie. Angeblich voller Vitamine, Superfoods und Hoffnung. Tatsächlich: ein flüssiger Wald aus Algen, Spinat und Spirulina. Schmeckt, als hätte man einen Frosch durch ein Sieb gepresst und ihn danach gefragt, ob er glücklich ist.
Ich nippe vorsichtig. Es fühlt sich an wie Gesundheitsfaschismus mit biologischem Gütesiegel. Irgendwo im Netz hat ein Influencer behauptet, dass genau dieser Smoothie sein Leben verändert hat. Ich frage mich, in welches. Vielleicht in ein Leben, in dem man mit Pflanzen spricht und seine Steuererklärung in Sanskrit schreibt.
Während ich das grüne Elend schlürfe, beobachte ich mich selbst durch die Frontkamera meines Laptops. Ich sehe aus wie jemand, der zu viele TED Talks gesehen hat, aber keinen davon verstanden hat. Meine Haare stehen in einem Winkel, den selbst Pythagoras nicht erklären könnte. Mein Gesichtsausdruck: das emotionale Äquivalent eines leeren Akkus.
Ich öffne erneut Chrome. Der achte Tab ist längst überschritten. Es sind 23. Jeder davon ein Versuch, der Realität zu entkommen. Google Docs, YouTube, Pinterest-Boards mit „minimalistischen Wohnideen“, obwohl meine Wohnung aussieht wie ein Second-Hand-Büro.
Ich öffne Tab 19: „Wie werde ich endlich diszipliniert?“ Die ersten drei Links führen zu Selbsthilfeblogs mit Titeln wie „Du bist dein eigener Guru“ oder „Steh auf und sei du selbst – in nur 5 Schritten zum inneren Tiger“. Ich möchte kotzen. Wahrscheinlich grün.
Ich frage mich, ob die Menschen, die diese Blogs schreiben, auch morgens aufwachen und denken: Heute nicht. Oder ob sie wirklich um 5:00 Uhr joggen, dann meditieren, dann Selleriesaft trinken und dann mit der Sonne reden. Und ob die Sonne ihnen antwortet.
Ich starre auf meinen Smoothie. Er starrt zurück. Ich glaube, er bewegt sich.
Ich öffne Tab 20: „Was tun bei latenter Lebensverweigerung mit Tendenz zur Soft-Apokalypse?“ Keine konkreten Tipps. Nur ein Forum voller Menschen, die sich gegenseitig GIFs von brennenden Mülleimern schicken. Ich fühle mich verstanden.
Ich denke an Sport. An Joggen. An Yoga. An Apps, die mir sagen, dass ich ein besserer Mensch werden kann, wenn ich nur 7 Minuten lang schwitze, als würde ich gerade vor meinem Selbstbild weglaufen. Ich lade eine runter. Ich lösche sie wieder. Ich weiß, wie das endet.
In einem Moment geistiger Umnachtung öffne ich Tab 21: „Koch dich glücklich – 108 Rezepte für ein erfülltes Leben“. Ich scrolle zu einem Gericht namens „Seelenschmeichler-Bowl mit fermentierter Rote Bete“. Ich weine ein bisschen. Nicht wegen der Zwiebeln. Wegen der Wortwahl.
Ich frage mich, wann genau „Selbstoptimierung“ zu einer Ersatzreligion geworden ist. Wann wir aufgehört haben, einfach nur zu existieren – und stattdessen begonnen haben, unsere eigene Produktivität zu gamifizieren. Ich wünsche mir, dass jemand kommt, mein WLAN kappt und mich zwingt, einfach mal wieder ein Sandwich zu essen, ohne zu hinterfragen, ob das Brot auch „glücksfördernd“ ist.
Ich gehe in die Küche. Öffne den Kühlschrank. Drin: Senf, Gurkenwasser, ein hartes Stück Käse und ein abgelaufener Joghurt, der sich mittlerweile wahrscheinlich selbst vermarkten könnte als „Probiotisches Retroerlebnis“.
Ich greife zum Käse. Schneide ihn. Esse ihn. Ohne Musik. Ohne Bildschirm. Nur ich und der Käse. Es ist… real.
Zurück am Rechner öffne ich Tab 22: „Wie finde ich wieder zu mir selbst?“ Die Antwort: „Du warst nie weg. Nur zu viel online.“
Ich schließe den Tab. Schließe alle Tabs. Leere den Papierkorb. Ich atme. Der Smoothie bleibt stehen. Ich habe gewonnen. Für heute.
🔁 Kapitel 6: Und täglich grüßt der Reminder
Es beginnt mit einem Pling. Kein dramatisches Geräusch. Kein Kanonenschlag. Nur ein kleines akustisches „Du hast was vergessen“, direkt aus dem Zentrum meiner digitalen Selbstverachtung. Mein Kalender erinnert mich an etwas, das ich gestern ignoriert habe, vorgestern verdrängt und letzte Woche panisch gelöscht hatte: „Selbstfürsorge“. Schön eingetragen. Bunt markiert. Mit Alarm.
Ich ignoriere es. Natürlich. So wie ich auch das letzte Zoom-Meeting ignoriert habe, in dem jemand sagte: „Wir müssen uns selbst wie ein Projekt behandeln.“ Ich bin kein Projekt. Ich bin ein leerer Zwischenstand mit Kaffeeflecken auf der Timeline.
Ich öffne den Kalender. 18 Termine. Davon 16 mit mir selbst. „Meditation“, „Trink Wasser“, „Kein Bildschirm nach 22 Uhr“, „Sinn finden“. Ich erkenne in meinem Zeitplan den Versuch eines verzweifelten Ichs, Ordnung ins Chaos zu schreiben. Ich war das. Ich habe mir selbst Termine erstellt, die mich retten sollten. Ironisch, dass sie mich jetzt überfordern.
Ich lösche sie alle. Mit einem Klick. Die Freiheit riecht nach digitalem Staub und Passiv-Aggression. Für genau fünf Sekunden.
Dann öffne ich Chrome. Wieder Tabs. Wieder die Kälte der Optionen. Wieder das Gefühl, dass jede Website ein Spiegel ist, der schreit: „Du hättest mehr sein können.“
Ich schreibe eine To-do-Liste:
- Früh aufstehen
- Nicht sofort Handy
- Irgendwas mit Gemüse
- Weniger Tabs
- Mehr Fokus
- Weniger Listen
- Mehr sein
- Weniger tun
- Kaffee
Punkt 9 ist der einzige, den ich sofort abhaken kann. Und auch der einzige, der ehrlich ist.
Ich koche mir noch einen. Kaffee Nummer fünf. Oder sechs. Ich hab aufgehört zu zählen, als ich gemerkt habe, dass mein Herz im Takt der Outlook-Erinnerung schlägt. Ich öffne Google Docs. Dieses Dokument. Diesen Text. Diesen letzten Versuch, etwas zu ordnen, das nicht geordnet werden will.
Ich schreibe weiter, obwohl alles in mir sagt: „Mach doch mal Pause.“ Aber wenn ich pausiere, denke ich. Wenn ich denke, vergleiche ich. Und wenn ich vergleiche, verliere ich.
In einem der Tabs läuft Lo-Fi-Musik. „Lo-Fi Hip Hop – beats to dissociate to while pretending to work.“ Mein Soundtrack. Mein Leben. Meine Default-Stimmung.
Ich sehe in den Spiegel über meinem Schreibtisch. Er ist dreckig. Mein Spiegelbild verschwommen. Und ich denke: Vielleicht ist das gut so. Vielleicht muss man nicht immer alles klar sehen. Vielleicht reicht es, wenn man atmet. Kurz. Einmal. Und dann… weiter.
Der Reminder klingelt nochmal. „Atmen nicht vergessen.“ Ich lache. Leise. Kurz. Ich vergesse es trotzdem.
Und dann? Dann schließe ich alle Tabs. Einen nach dem anderen. Ohne Backup. Ohne Absicherung. Ich lehne mich zurück. Schaue auf den leeren Desktop. Und denke: Vielleicht liegt der Sinn des Lebens nicht zwischen Kaffee und Chrome-Tabs.
Vielleicht liegt er genau hier.
Im Nichts.
Im Moment zwischen zwei Erinnerungen.
Wo kein Reminder mehr klingelt.
Und das Denken kurz – ganz kurz – aufhört.
🧩 Fazit: Und was bleibt?
Ein Haufen Tabs. Ein halbleerer Kaffee. Und der flüchtige Gedanke, dass man vielleicht doch nicht alles verstehen muss, um zu überleben.
Wir leben in einer Zeit, in der wir gleichzeitig überall und nirgends sind. In der unser Browser-Verlauf mehr über uns aussagt als jedes Bewerbungsschreiben. In der ein Reminder unsere spirituelle Führung ersetzt.
Aber vielleicht ist das okay. Vielleicht müssen wir aufhören, den Sinn des Lebens zu suchen, als sei er eine PDF-Datei mit dem Namen Final_final_wirklich_FINAL.pdf. Vielleicht reicht es, wenn wir hin und wieder innehalten. Einen Tab schließen. Einen Schluck trinken. Tief durchatmen.
Denn was bleibt, wenn man alle Tabs geschlossen, alle Erinnerungen aus dem Kalender gelöscht und sogar den letzten Coffee-To-Go geleert hat? Man selbst. Kein perfektes Selbst. Kein optimiertes Ich. Sondern das chaotische, unvollständige, denkende, fühlende Wesen, das irgendwo zwischen To-do-Liste und TikTok tanzt.
Die Wahrheit ist: Der Sinn des Lebens kommt nicht als Push-Nachricht. Er steht nicht in einem Selbsthilfebuch mit der Aufschrift „99 Wege zu deinem wahren Ich“. Der Sinn ist nicht SEO-optimiert, nicht filterbar, nicht in der Dropbox gespeichert. Er ist flüchtig. Subtil. Manchmal absurd. Und oft nur in der Rückschau erkennbar – wie ein schlechter Film, der plötzlich einen großartigen Abspann hat.
Wir sind keine Maschinen, die durch Effizienz zu Erleuchtung finden. Wir sind Menschen, die manchmal starren, klicken, löschen und anfangen. Und nochmal anfangen. Und wieder aufhören.
Vielleicht liegt der Sinn nicht darin, alles zu erledigen, sondern das Gefühl zuzulassen, dass es niemals alles sein wird. Vielleicht liegt er im Moment, wenn du feststellst, dass du gar nicht wissen musst, wohin – sondern nur, dass du gehst.
Und wenn es gut läuft: mit Kaffee in der Hand.
Vielleicht ist es auch das: Der Sinn des Lebens liegt nicht zwischen den Tabs. Er liegt trotz ihnen. In dir.
Du bist kein Browser. Du bist der Nutzer.
Und wenn du das hier bis zum Ende gelesen hast, hast du vielleicht etwas gefunden, das du nicht bei Google eingetippt hast.
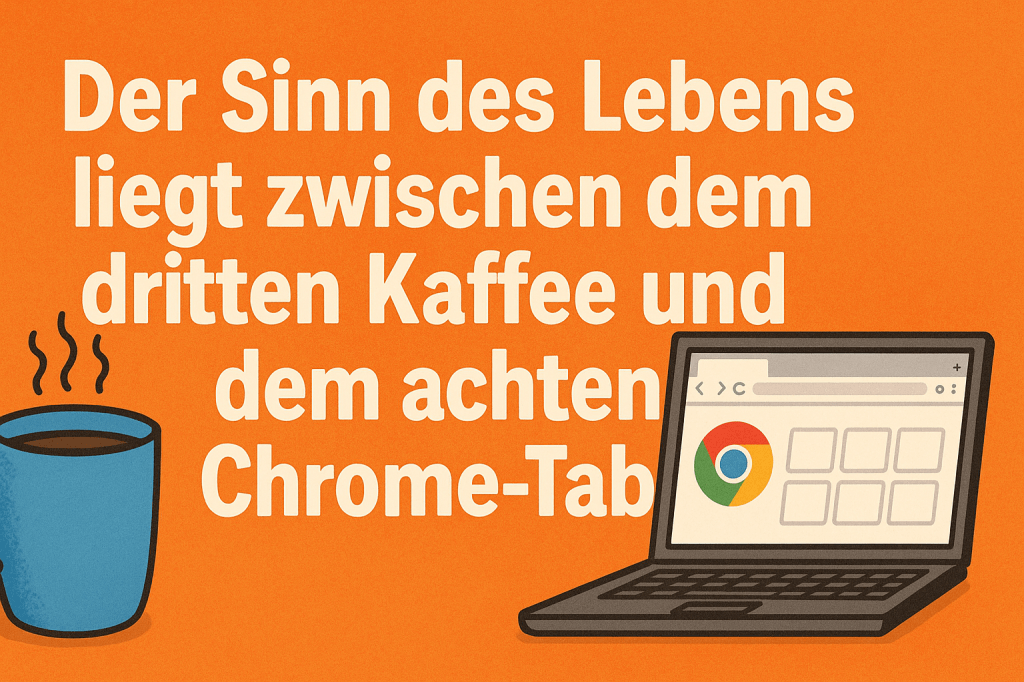
Entdecke mehr von Der BROWNZ Blog
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.











